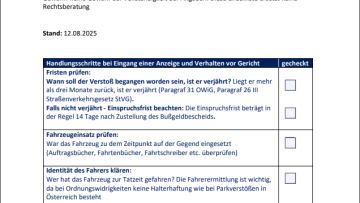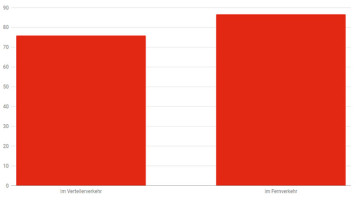Am heutigen Dienstag, den 11.11.2025, fällt der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung zur EU-Richtlinie über angemessene Mindestlöhne, wie die dpa vermeldet: Die Richter der Großen Kammer prüfen, ob das 2022 beschlossene Regelwerk mit den europäischen Verträgen vereinbar ist. Dänemark, unterstützt von Schweden, hat Anfang 2023 Klage eingereicht. Das Argument: Die EU habe ihre Kompetenzen überschritten, da der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union zwar Regelungen zu Arbeitsbedingungen erlaubt, nicht aber zur Höhe des Arbeitsentgelts.
Update von 10:05 Uhr:
Der Europäische Gerichtshof hat zwei zentrale Bestimmungen der EU-Richtlinie über angemessene Mindestlöhne für nichtig erklärt: Damit wird die Klage Dänemarks teilweise stattgegeben, meldete die dpa.
Update von 11:25 Uhr:
Die EU hat dem EuGH zufolge bei der Festlegung von einheitlichen Standards für Mindestlöhne ihre Kompetenzen überschritten, wie die dpa weiter vermeldet: In Luxemburg wurden nun zwei Bestimmungen in der EU-Mindestlohnrichtlinie für nichtig erklärt. Dies sind einerseits um Kriterien für die Festlegung und Aktualisierung der Löhne und andererseits eine Vorschrift, die eine Senkung der Löhne unterbindet, wenn sie einer automatischen Indexierung unterliegen.
Es sei ein unmittelbarer Eingriff in die Festsetzung des Arbeitsentgelts, dass der EU-Gesetzgeber Kriterien für die Festlegung der Mindestlöhne aufgeführt habe, so das Urteil, da die Höhe der Löhne nach den EU-Verträgen Angelegenheit der Mitgliedstaaten ist. Die EU dürfe mit Richtlinien lediglich etwa die Arbeitsbedingungen regeln. Gleiches gelte für die Vorschrift, die eine Senkung der Löhne unterbindet, wenn sie einer automatischen Indexierung unterliegen.
Die Mindestlohnrichtlinie bleibt dem Urteil zufolge im Übrigen bestehen. Sie verpflichtet die Länder damit weiterhin, auf hohe Abdeckungsraten von Tarifverträgen hinzuwirken.
Der EuGH verneinte damit einen unmittelbaren Eingriff in das Koalitionsrecht, das ebenfalls in der Zuständigkeit der EU-Länder liegt. Die Bestimmung verpflichte die Mitgliedstaaten nämlich nicht, zu regeln, dass mehr Arbeitnehmer einer Gewerkschaft beizutreten haben, so die dpa.
Für Deutschland bedeutete dies, dass weiterhin einen Aktionsplan zur Steigerung der Tarifbindung erbracht werden muss. Dies soll den Angaben zufolge bis zum 31. Dezember geschehen. "Entgegen dem europäischen Trend ist die Tarifabdeckung in Deutschland in den letzten zwei Dekaden rapide gesunken, auf um die 50 Prozent", sagte der Politikwissenschaftler Martin Höpner vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung der dpa: Dies sei dramatisch, der deutsche Gesetzgeber sollte hier unbedingt mehr tun, so Höpner weiter. Dies könne er jedoch sowohl mit als auch ohne EU-Richtlinie.
Hintergrund: Was steht auf dem Spiel?
Sollte die Richtlinie für nichtig erklärt werden, entfällt die Diskussion in Deutschland, ob nationale Mindestlohnregelungen an EU-Recht angepasst werden müssen. Die Richtlinie sieht unter anderem vor, dass Mitgliedstaaten den Mindestlohn an einem Referenzwert ausrichten – konkret 60 Prozent des mittleren Bruttolohns. Dabei handelt es sich um den Lohn, bei dem 50 Prozent der Beschäftigten mehr und 50 Prozent weniger verdienen.
Mindestlohn in Deutschland: Reicht das?
Die Bundesregierung hat beschlossen, den Mindestlohn von derzeit 12,82 Euro zum 1. Januar auf 13,90 Euro und ein Jahr später auf 14,60 Euro pro Stunde anzuheben. Nach Berechnungen von Gewerkschaften müsste er bei Anwendung des EU-Referenzwertes jedoch über 15 Euro liegen.
Tarifbindung und Aktionsplan
Die Richtlinie verlangt außerdem einen Aktionsplan zur Förderung von Tarifverhandlungen, wenn weniger als 80 Prozent der Beschäftigten tarifgebunden sind. In Deutschland liegt die Quote zuletzt bei rund 50 Prozent – deutlich unter der Schwelle. Damit wäre ein solcher Plan verpflichtend.