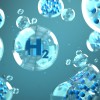Seit 2020 rollen in der Schweiz rund 50 Brennstoffzellen-Lkw im Alltagseinsatz. Die Fahrzeuge zeigen hohe Zuverlässigkeit und kurze Betankungszeiten. Auch in Deutschland wurde 2022 ein Serienmodell vorgestellt – ein wichtiger Meilenstein für den Schwerlastverkehr. Erste Rückmeldungen aus dem Testbetrieb sind positiv: Fahrer loben das Fahrverhalten, die Disposition funktioniert wie beim Diesel.
Infrastruktur bleibt der Engpass im Wasserstoff-Transportnetz
Die Technik überzeugt – doch die Wasserstoff-Infrastruktur für Lkw hinkt hinterher. Das Unternehmen H2 Mobility betreibt aktuell insgesamt gut 70 Wasserstofftankstellen in Deutschland, die zum Teil auch Betankungen von sowohl Pkw als auch Lkw ermöglichen. Über 30 der Tankstellen ermöglichen eine Betankung mit 350 Bar – typisch für Nutzfahrzeuge wie Lkw und Busse. 2024 verzeichnete das Unternehmen laut seinem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht rund 156.000 Betankungsvorgänge, davon waren 16.000 für Busse und Lkw.
Der Fokus beim Ausbau solcher Nutzfahrzeug-Tankstellen liegt auf sogenannten Cluster-Regionen wie Rhein-Ruhr und Rhein-Neckar. Dennoch fehlt vielerorts Redundanz – ein Problem für Flottenmanager mit zeitkritischen Touren.
Auch die Betriebskosten sind ein Knackpunkt. Ohne Fördermittel ist der Einsatz wirtschaftlich kaum darstellbar. Die Total Cost of Ownership (TCO) liegt noch über Diesel und BEV. Hinzu kommt die Unsicherheit bei der Tanktechnik: 350 bar, 700 bar oder flüssiger Wasserstoff? Laut H2 Mobility steigt die Nachfrage nach 350-bar-Betankung – ein Hinweis auf die zunehmende Nutzung im Nutzfahrzeugsegment.
„Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Unsere Investitionen in die 350-Bar-Infrastruktur tragen Früchte. Der Schwerlastverkehr wird zunehmend zum Treiber der Wasserstoffmobilität“, sagte Martin Jüngel, Geschäftsführer & CFO des Unternehmens Anfang Juni 2025. Demnach überstieg im März dieses Jahres der Absatzanteil von 350 bar mit über 50 Prozent erstmals in der Unternehmensgeschichte den von 700 bar. Gleichzeitig erreichte der absolute Wasserstoffabsatz ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.
EU-Regulierung: AFIR-Verordnung soll Wasserstofftankstellen ausbauen
Politisch setzt die EU mit der AFIR-Verordnung (EU 2023/1804) klare Rahmenbedingungen: Bis Ende 2030 müssen die Mitgliedstaaten eine Mindestanzahl öffentlich zugänglicher Wasserstofftankstellen errichten – insbesondere entlang der TEN-T-Korridore. Das soll Investitionen erleichtern und Planungssicherheit schaffen.
Prognosen zeigen: Wasserstoff bleibt relevant. Bis 2030 sollen laut den Nutzfahrzeugherstellern rund 17 Prozent der Neuzulassungen bei schweren Lkw über 12 Tonnen auf Brennstoffzellen-Fahrzeuge entfallen – das entspricht etwa 17.200 Fahrzeugen. Parallel steigt die Zahl batterieelektrischer Lkw auf 56 Prozent, während Diesel auf 26 Prozent fällt. Das sind Zahlen aus dem „Fortschrittsbericht zum Gesamtkonzept klimafreundliche Nutzfahrzeuge“ des Bundesverkehrsministeriums von 2022. Ab 2027 kommt der H2-Verbrenner hinzu.
Wo Wasserstoff-Lkw punkten können
Besonders geeignet sind Wasserstoff-Trucks für planbare Langstrecken, Systemverkehre und Expresslogistik. Dort zählt jede Minute – und die kurze Betankungszeit ist ein Vorteil gegenüber batterieelektrischen Fahrzeugen. Voraussetzung: eine stabile Infrastruktur und klare Kostenperspektive.
Für Unternehmensberater Kay Simon ist Wasserstoff als künftige Alternative zu BEV-Mobilität zumindest eine Option, die nicht in Vergessenheit geraten sollte.
„Die Schweiz zeigt, wie es gehen kann: Fahrzeuge und Infrastruktur wurden dort parallel entwickelt – mit beeindruckender Alltagstauglichkeit“, so Simon.
Auch den H2-Verbrenner sieht er als erfolgversprechende Option: „Ab 2027 kommt der H2-Verbrenner – das ist mehr als eine Übergangstechnologie, sondern ein ernstzunehmender Wettbewerber zur Brennstoffzelle.“
Nicht alle Transportsegmente eignen sich, doch Systemverkehre, Begegnungsverkehre und zeitkritische Langstrecken bleiben ideale Einsatzfelder für Wasserstoff-Lkw.
Blick über den Tellerrand: Wasserstoff in der Schifffahrt als Vorbild
Auch in der maritimen Industrie gewinnt Wasserstofftechnologie an Bedeutung – mit konkreten Erfolgen:
- Silver Nova: Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft mit dem bislang größten Brennstoffzellensystem auf See – ein Meilenstein für emissionsarme Kreuzfahrten.
- RH₂INE-Projekt: Entlang des Rheins entsteht ein grenzüberschreitendes Wasserstoffnetz für Binnenschiffe – für klimaneutralen Güterverkehr zwischen Rotterdam und Köln.
- FuelEU Maritime und RED III: EU-Verordnungen und Richtlinien setzen verbindliche Ziele für erneuerbare Kraftstoffe in der Schifffahrt – Wasserstoff und Ammoniak gelten als Schlüsseltechnologien.
- Niederlande als Vorreiter: Erste Frachtschiffe mit Brennstoffzellenantrieb sind bereits unterwegs, flankiert von gezieltem Infrastrukturausbau in den Häfen.
Diese Beispiele zeigen: Wasserstoff ist bereits Realität – auf See und auf der Straße. Die Erfahrungen aus der Schifffahrt können dem Straßengüterverkehr als Blaupause dienen, besonders bei Infrastruktur, Standardisierung und Skalierung.