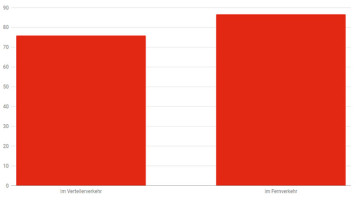Ob Smartphones, Hygieneartikel oder Wohnaccessoires – ein Großteil unserer Konsumgüter durchläuft globale Lieferketten, bevor sie in deutschen Regalen landen. Über 90 Prozent des Welthandels erfolgt über den Seeweg. Täglich transportieren rund 50.000 Handelsschiffe Waren im Wert von bis zu 20 Milliarden US-Dollar. Allein der Suezkanal verarbeitet etwa 50 Schiffe pro Tag – mit Fracht im Wert von rund 9 bis 10 Milliarden Dollar. Die größten Containerschiffe fassen über 20.000 TEU, das entspricht etwa 10.000 Lkw-Ladungen.
Der globale Handel ist ein eng getaktetes, hocheffizientes Netzwerk. Doch genau darin liegt auch seine größte Schwachstelle: Schon kleinere Störungen können weltweite Auswirkungen haben – wirtschaftlich, logistisch und gesellschaftlich.
Krisen offenbaren die Verwundbarkeit
Die vergangenen fünf Jahre zeigen, wie anfällig globale Lieferketten sind.
- Corona-Pandemie: Produktionen kamen weltweit zum Erliegen, Häfen standen still, Lieferzeiten vervielfachten sich, Preise stiegen.
- „Ever Given“-Havarie im Suezkanal: Über 400 blockierte Schiffe, Milliardenverluste und Lieferverzögerungen.
- Chip-Krise: Produktionsausfälle, geopolitische Spannungen und hohe Nachfrage legten die Auto- und Elektronikindustrie lahm.
- Krieg in der Ukraine: Energie, Getreide, Metalle und Düngemittel wurden knapp – Verbraucherpreise zogen an.
- Krise im Roten Meer: Angriffe auf Handelsschiffe zwingen zu Umwegen um Afrika, verlängern Transportzeiten um bis zu zwei Wochen.
Lieferengpässe im Alltag spürbar
Die Folgen sind längst bei Verbrauchern und Unternehmen angekommen: Ersatzteile, Maschinen oder Elektronik lassen auf sich warten. Selbst Alltagsprodukte wie Kaffee oder Schokolade werden teurer, weil Transportkosten steigen. Für Logistikunternehmen bedeutet das mehr Unsicherheit, ständiges Umplanen und knappe Ressourcen bei Fahrern, Trailern und Lkw.
Podcast-Tipp
In unserem Podcast „Resiliente Lieferketten – Herausforderungen und Chancen“ sprechen wir mit Experten über konkrete Strategien, um Lieferketten widerstandsfähiger zu machen.
Hier den Podcast zum Thema hören:
Lieferkettengesetz verschärft die Lage
Seit 2023 gilt in Deutschland das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Es verpflichtet Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden, entlang der gesamten Lieferkette Menschenrechte und Umweltstandards einzuhalten. Unternehmen müssen unter anderem:
- Risiken wie Kinderarbeit oder Umweltzerstörung identifizieren und Gegenmaßnahmen ergreifen
- ein Beschwerdeverfahren, Risikomanagement und jährliche Berichte einführen
Verstöße können hohe Bußgelder und den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen nach sich ziehen. Kurzfristige Lieferantenwechsel oder Umstrukturierungen werden dadurch deutlich schwieriger.
Resilienz als Schlüssel
Immer mehr Unternehmen setzen auf Maßnahmen wie höhere Lagerbestände, mehr Lieferanten oder regionale Produktion. Diese Schritte erhöhen die Stabilität, verursachen jedoch auch mehr Kosten und binden Kapital – besonders für kleine und mittlere Unternehmen eine Herausforderung.
Digitalisierung und Partnerschaften
Digitale Technologien und Datenanalysen helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen. Strategische Partnerschaften mit verlässlichen Akteuren sowie die Diversifizierung von Transportwegen sind zentrale Bausteine. Ebenso wichtig ist die Qualifizierung der Mitarbeitenden, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.
Politik gefordert
Förderprogramme und Handelsabkommen allein reichen nicht. Es braucht leistungsfähige Häfen, moderne Bahnknoten und stabile Landrouten. Auch digitale Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Verwaltung müssen verbessert werden.
Fazit: Vorausschauend agieren
Resilienz ist kein Luxus, sondern Überlebensstrategie. Lieferketten müssen so gestaltet sein, dass sie politische Schocks, Naturkatastrophen oder Krisen abfedern können. Digitale Transparenz, flexible Strukturen und vielfältige Lieferantenbeziehungen sind entscheidend, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.