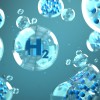Großunternehmen, Flughäfen und Forschungseinrichtungen in Hessen haben einen enormen Stromhunger – doch die Energie soll zunehmend aus erneuerbaren Quellen stammen. Gleichzeitig steigt der Anteil der Eigenproduktion und die Energieeffizienz.
Laut Energiemonitoringbericht 2023 lag der gesamte Stromverbrauch in Hessen bei 37,4 Terawattstunden (TWh). 27 % davon entfallen auf die Industrie, 42 % auf Gewerbe, Handel und Dienstleistungen – inklusive Rechenzentren. In den letzten zehn Jahren stieg der Anteil erneuerbarer Energien deutlich, während der Industrie-Stromverbrauch sank.
Beispiel Merck: 70 % Strom aus eigener Erzeugung
Der Pharma- und Technologiekonzern Merck in Darmstadt verbraucht jährlich rund 150 Millionen Kilowattstunden (kWh).
Etwa 70 % des Stroms werden direkt am Standort produziert, der Rest stammt aus dem öffentlichen Netz. Seit 20 Jahren wird systematisch Energie eingespart, und das Unternehmen ist nach ISO 50001 für Energiemanagement zertifiziert.
Frankfurter Flughafen: Mehr Passagiere, mehr Strombedarf
Der Flughafenbetreiber Fraport verbrauchte 2024 rund 296 Millionen kWh Strom, der gesamte Flughafen sogar 539 Millionen kWh.
Mit der Eröffnung des Terminals 3 wird der Bedarf weiter steigen. Ein Vertrag mit einem Windkraftbetreiber liefert künftig 370 Millionen kWh grünen Strom pro Jahr.
Bis spätestens 2045 will Fraport treibhausgasneutral sein, 2025 soll der Anteil grüner Energie bei 96 % liegen.
K+S: Hoher Energieeinsatz für Salz- und Düngemittelproduktion
Der Dünger- und Salzkonzern K+S verbrauchte 2024 11,3 Milliarden kWh, davon 8,9 Milliarden kWh aus Erdgas. Die Wärme aus Erdgas wird für den Abbau und die Verarbeitung von Rohsalzen benötigt.
Zukünftig soll die Wärmeerzeugung weitgehend elektrifiziert werden, was den Gasverbrauch reduziert, den Strombedarf jedoch erhöht. Seit 1990 senkte K+S die Emissionen an aktiven Standorten um mehr als 60 %.
GSI Helmholtzzentrum: Teilchenforschung mit Ökostrom
Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt benötigte 2024 rund 57 Millionen kWh, komplett aus 100 % Ökostrom.
Mit dem Ausbau eines größeren Teilchenbeschleunigers wird der Bedarf auf 270 Millionen kWh steigen. Hier entstehen magnetische Felder, Pumpen und Kühlanlagen, um Teilchen nahezu auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen – für Forschung in Astrophysik, Medizin und Grundlagenwissenschaft.