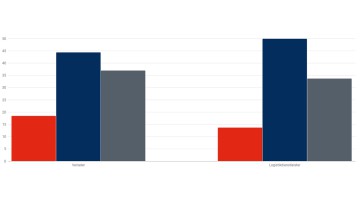Hamburg. In der Weltcontainer-Flotte wurden 2009 so viele Schiffe verschrottet wie innerhalb eines ganzen Jahrzehntes. Rund 200 Frachter wurden von den Reedereien aus der Fahrt genommen, um sie dem Alteisen zuzuführen. Damit wurden zugleich gut 370.000 TEU (Standardcontainer) Transportkapazität aus dem Markt genommen. Bemerkenswert ist zudem, dass in diese Verschrottungskampagne auch vergleichsweise „junge“ Schiffe einbezogen wurden. So wanderte beispielsweise der erst 17 Jahre alte Frachter „Hyundai Admiral“ (4650 TEU) in den Hochofen. Die Verschrottungsaktion, die sich nach Experteneinschätzung auch im laufenden Jahr wiederholen wird, sollte einen Beitrag leisten, um das Tonnageüberangebot zu verringern. Dazu kam es als Folge der Weltwirtschaftskrise und einem geradezu ungehemmten, bis weit ins Jahr 2008 währenden Bestellungsrausches. Eine andere Maßnahme, um Tonnage zu binden, bestand im Auflegen von Schiffen. Das bedeutet, dass ein Schiff zeitweise außer Betrieb genommen wird. Bis Jahresende 2009 hatte sich die Anzahl der weltweit aufgelegten Containerschiffe bei rund 550 Frachtern eingependelt. Zur Jahresmitte waren es sogar mehr als 700 Schiffe. In anderen Fällen bemühten sich Reedereien darum, Neubauverträge aufzulösen oder zumindest eine Verschiebung der Fertigstellung zu erreichen. Vor allem südkoreanische Werften, auf denen die „XXL“-Containerschiffe entstehen, zeigten sich dabei sehr hartnäckig. Die im vergangenen Jahr erfolgte Rekordverschrottung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit nur ein Bruchteil der 2009 neu in Fahrt genommenen Kapazitäten kompensiert werden konnte. So stellten die Reedereien allein 286 neue Containerschiffe mit einer Stellplatzkapazität von 8000 TEU und mehr in Dienst. Diese Frachter sind die neuen Arbeitspferde in den wichtigen Schifffahrtsmärkten, allen voran dem Fahrtgebiet Europa-Fernost. Bis 2012 werden noch einmal 415 "XXL"-Containerschiffe dazukommen. Als weitere Maßnahme zur Kapazitätsbindung setzt sich bei immer mehr Reedereien auf den Fernrouten das Slow Steaming durch, also die deutliche Verrringerung der Reiseschwindigkeit. Statt um 21 bis 22 Knoten sind es bis zu zehn Knoten weniger. Der Marktriese Maersk beispielsweise setzt auf ein „Super-Slow-Steaming“ auf den langen Routen von um die zwölf Knoten. Ein Unternehmen wie Hamburg Süd hat für einen Teil seiner Dienste eine Reisegeschwindigkeit von 16 Knoten festgelegt. Der Schiffsklassifizierer Germanischer Lloyd geht davon aus, dass sich eine Geschwindigkeit um 14 Knoten durchsetzen wird. (eha)
Containerschifffahrt: Mehr als 200 Frachter wurden zu Alteisen

Auch vergleichsweise junge Tonnage wurdeverschrottet / Maßnahme ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, um Übertonnage abzubauen